Gundolf S. Freyermuth (Gastherausgeber): Intermedialität // Transmedialität, FIGURATIONEN 02/07, herausgegeben von Barbara Naumann, Köln: Böhlau. Erschienen März 2008
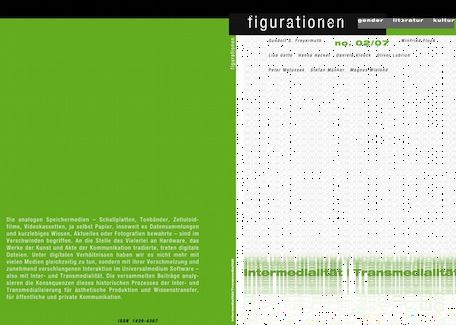
Einleitung zu der Ausgabe
Von Gundolf S. Freyermuth
Mit dem Eintritt ins digital realm, ins Reich des Digitalen, verändern sich die tradierten Medien und insbesondere ihr Verhältnis zueinander nachhaltig. Das Resultat der medialen Analog-Digital-Konversion, der Ersetzung einst analoger Artefakte – ihrer ästhetischen Qualitäten wie ihrer Gehalte – durch Software, suchen Praktiker wie Theoretiker unter dem Begriff des Transmediums zu fassen. Einer Verständigung darüber, was das Kompositum genau bezeichnet, arbeitet freilich entgegen, dass allererst Medium mit einiger Verbindlichkeit zu definieren wäre.
Adäquate Speicherung ist nun aber kein peripheres Element künstlerischer Produktion wie alltäglicher Kommunikation. Ob Medien Speicherung und damit Tradierung ermöglichen und nicht minder, wie sie das leisten, präfiguriert ihren Gebrauch. Die analoge Ordnung der Künste und Kommunikationsformen beruhte zudem vorrangig auf Materialität, den Mitteln und Medien. Deren radikale Unifizierung erfordert daher eine Re-Evaluierung der Kunst- beziehungsweise Mediengeschichte. Sie unternehmen die nachstehenden Aufsätze und Essays.
Die Basis legen zwei Beiträge, die Stoffe und Medien in ihrem Wandel über die Jahrhunderte darstellen. Peter Matussek verfolgt die Migrationen des Orpheus-Mythos. Von den visuellen Varianten des griechischen Ursprungs führen sie zunächst in die eskalierende Vertextung – aus dem lauten Lesen seit der römischen Antike in die bald stumme und einsame Lektüre nach Renaissance und Reformation. Mit der Moderne stößt der Mythos so an mediale Limitierungen und migriert erneut, zu mechanischen Zeiten in Oper und Operette, mit der Industrialisierung in den Tonfilm. Die Digitalisierung schließlich bringt über die tendenzielle Taktilisierung des Auditiven die dialektische Konfrontation des Orphischen mit seinen schamanistischen Wurzeln, die Kombination musikalischer Verzauberung mit vegetativer Verzückung.
Matusseks thematisch orientierten Blick auf Inter- und Transmedialität ergänzt Lisa Gotto medienhistorisch. Der Entwicklung optischer Medien von Camera obscura und Laterna magica über die theatralischen Beleuchtungstechniken der industriellen Frühzeit zur Schattenwelt des Kinos folgend, etabliert sie das Dunkel als Bedingung technisch ermächtigter Lichtbilder und der mit ihr verbundenen Anstrengung, Blickweisen effektiv zu kontrollieren. Mit dem Fernsehen freilich beginnt eine Marginalisierung des Dunkels als Kondition audiovisueller Produktion wie Rezeption, die in der Arbitrarität digital-elektronischer Bildlichkeit kulminiert.
Die Anstrengung, Vertrautes unter digitaler Perspektive neu zu sehen und zu verstehen, setzt sich dann in vier Aufsätzen fort, die sich auf Stationen der industriellen Mediengeschichte konzentrieren.
Am Beispiel Alexander von Humboldts demonstriert Oliver Lubrich die frühindustriellen Anfänge der Medialisierung von Wissensproduktion und Wissenstransfer. Gegen die Reduktion dessen, was mit allen Sinnen erfahren und zudem mit einer Vielzahl technischer Instrumente vermessen wurde, aufs Monomedium Text führte von Humboldt ins Feld, was zu seiner Zeit medientechnisch existierte: eine Verschmelzung von Text und Bild, die das Medium Buch nach dem Vorbild von Ausstellungen tendenziell nonlinear inszenierte; innovativ-informative Bildsorten, die realistische Reproduktion mit grafisch-tabellarischer Verdatung kombinierten; schließlich die Utopie naturkundlicher Erlebnisräume, die Wissen nach dem Muster zeitgenössischer A/V-Unterhaltungen wie Panorama oder Diorama vermitteln sollten. Der Kombination der Disziplinen entsprach so die der Medien, der Interdisziplinarität der Forschung die Inter-, gar Multimedialität ihrer Präsentation.
Operierte von Humboldt noch an der Grenze zu den industriellen Medien, so markiert der Erfolg des Indianerfotografen Edward S. Curtis um 1900 deren Durchsetzung. Wesentlich am Beispiel seiner Wirkungsgeschichte analysiert Winfried Fluck das Basiselement ästhetischer Erfahrung: den dialektischen Transferprozess, der zwischen Werk und Rezipienten vermittelt und ästhetische Erfahrung allererst konstituiert. Theoretisch führt Fluck damit Matusseks einleitende Überlegungen zugleich fort und in eine andere Richtung: Dem produktionsästhetisch orientierten Plädoyer für eine medienästhetische Migrationsforschung, welche in Anlehnung an die Wanderung der Menschen durch die Kulturen die der Stoffe durch die Medien verfolgt, korreliert aus rezeptionsästhetischer Sicht Flucks für alle medialen Fiktionen geltendes „transfer-model of the user-media relationship“.
Die Infragestellung des fotorealistischen Begriffs von Authentizität, die Fluck dabei in der Analyse des Werk-Rezipienten-Verhältnisses leistet, begründet Daniela Kloock für den Film medientechnisch wie medientheoretisch. Aus den Veränderungen der Bildqualitäten beim Übergang von der analogen Reproduktion des Wirklichen zu dessen virtueller Konstruktion mittels Datenkolonnen deduziert ihr Essay kulturelle Konsequenzen, insbesondere das Aufkommen diverser Hybridisierungen, einer Remix Culture, die ihre ästhetische Sprengkraft aus der Basierung aller Text-, Ton- und Bildmedien in einem gemeinsamen Kode bezieht.
Den Schlusspunkt bildet das im Verschwinden begriffene Fernsehen. Ein Medium wie jene vor ihm, schreibt Stefan Münker, war es ohnehin nie. Zu begreifen sei Fernsehen vielmehr als Dispositiv zur Produktion von Medien, als komplexe mediale Konstellation, „intrinsisch intermedial“. Bereits in seiner analog-elektronischen Gestalt ließ es sich nicht nur wie der Tonfilm anschauen, sondern dank der Kombination von laufenden und stehenden Bildern, von Ton und Text ebenso abgewandt hören oder zugewandt lesen. Die Ablösung massenhafter Distribution durch individuelle Abrufe, flankiert von textbasierten Online-Angeboten, die dem Nutzer neben der Programm- zunehmend Medienwahl offerieren, initiiere nun die „transmediale Neuerfindung des Mediums“.
Den facettenreichen Bogen, den die Autoren dieses Heftes schlagen, versuche ich mit Thesen zu einer Theorie der Transmedialität abzurunden. Sie verstehen Intermedialität, die wechselseitige Bezogenheit der Medien als ästhetische Konsequenz materiell separierter Speicherung mit mechanischen Mitteln; Multimedialität, die Addition analoger Medien, als ästhetische Konsequenz automatisierter (Re-)Produktion mit industriellen Mitteln; Transmedialität, die Integration der Medien, als ästhetische Konsequenz der Softwarewerdung, i. e. Virtualisierung.
Aus der vergleichenden Bestimmung von Inter-, Multi- und Transmedialem resultiert so die Notwendigkeit, zwischen analogen Medien und dem kategorial zu unterscheiden, was sie digital werden. Wichtiger als ein exakter Begriff des Mediums, den die analoge Vielfalt materiell separierter Medien als theoretisches Fundament wünschenswert erscheinen ließ, wird mit deren Konversion in transmediale Software ein Verständnis ihrer Effekte – dessen, was sie jeweils bewirken. Kurzum: eine Theorie der (Trans-) Medialität.